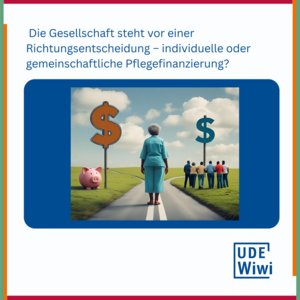Einzelansicht
Wed, 30. Jul 2025
Pflegekrise verschärft sich: Eigenanteile auf Rekordniveau – Zwei Reformvorschläge im Fokus
Berlin, Juli 2025 – Die Kosten für einen Pflegeheimplatz in Deutschland haben erstmals die Marke von 3.000 Euro monatlich Eigenbeteiligung überschritten. Wie der Verband der Ersatzkassen (vdek) berichtet, liegt der bundesweite Durchschnitt aktuell bei 3.108 Euro im ersten Jahr eines Heimaufenthalts – ein Anstieg um über acht Prozent innerhalb eines Jahres. Und auch langfristig bleibt die Belastung hoch: Selbst nach vier Jahren zahlen Pflegebedürftige im Schnitt noch rund 1.991 Euro monatlich.
Diese Entwicklung hat nicht nur soziale Brisanz, sondern auch haushaltspolitische Konsequenzen: Denn die Pflegeversicherung steht zusätzlich unter Druck. Nach aktuellen Prognosen tut sich bis 2029 ein Finanzloch von rund 12 Milliarden Euro auf. Die Pflege in Deutschland leidet damit unter einem doppelten Finanzproblem – bei Pflegebedürftigen wie im System selbst.
Zwei Konzepte für die Pflege-Reform
Die Politik ringt derzeit um Lösungsansätze, die die finanzielle Überforderung abmildern sollen. Zwei Modelle stehen im Zentrum der Debatte:
1. Kapitalgedeckte Zusatzversicherung (Vorschlag: Jürgen Wasem, Universität Duisburg-Essen)
Wasem schlägt vor, zusätzlich zur bestehenden Pflegeversicherung eine verpflichtende kapitalgedeckte Zusatzversicherung einzuführen, die gezielt die pflegebedingten Eigenanteile im Heim abdeckt. Beiträge sollen altersabhängig gestaffelt sein, Arbeitgeber die Hälfte tragen. Zwar sei das Modell nur bedingt für akut Pflegebedürftige wirksam, doch angesichts des demografischen Wandels sei es nötig, frühzeitig strukturell umzusteuern.
2. Vollversicherung mit Selbstbehalt (Vorschlag: Heinz Rothgang, Universität Bremen)
Rothgang favorisiert den Umbau zur Pflegevollversicherung: Die Versicherung soll alle Pflegekosten abzüglich eines festen Eigenanteils von 700 Euro übernehmen. Ergänzt wird sein Vorschlag durch ein neues Pflegegeld 2.0 für pflegende Angehörige – allerdings nur bei nachgewiesener Leistung. Finanziert werden soll dies durch eine stärkere Heranziehung von Gutverdienenden, inklusive Kapital- und Mieteinkünften, eine erhöhte Beitragsbemessungsgrenze, Steuerzuschüsse und einen Risikoausgleich zwischen gesetzlicher und privater Pflegeversicherung – als Schritt hin zur Bürgerversicherung.
Politische Reaktionen
In der CDU finden kapitalgedeckte Modelle Zustimmung. Kanzleramtsminister Thorsten Frei betont, dass die Pflegeversicherung ursprünglich als Teilleistungssystem konzipiert wurde: „Es bleibt notwendig, privat vorzusorgen.“
Die SPD zeigt sich offener für solidarisch finanzierte Systeme und zieht auch eine Bürgerversicherung in Erwägung. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt warnt jedoch davor, die Finanzierung zulasten der Beschäftigten zu privatisieren: „Die Risiken dürfen nicht zusätzlich privatisiert werden.“
Fazit
Die finanzielle Belastung für Pflegebedürftige hat ein neues Rekordniveau erreicht. Ohne Reform drohen nicht nur soziale Verwerfungen, sondern auch systemische Instabilität in der Pflegeversicherung. Die beiden derzeit diskutierten Modelle zeigen unterschiedliche Wege: mehr individuelle Vorsorge oder mehr solidarische Umverteilung. Beide benötigen politischen Willen – und mutige Entscheidungen.
Latest News:
 Wissenschaftspreise der Sparkasse Essen 2025: Dissertation von Dr. Lisa Sieger ausgezeichnet08.12.25
Wissenschaftspreise der Sparkasse Essen 2025: Dissertation von Dr. Lisa Sieger ausgezeichnet08.12.25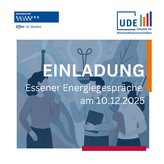 Essener Energiegespräche Spezial kehren am 10. Dezember 2025 zurück04.12.25
Essener Energiegespräche Spezial kehren am 10. Dezember 2025 zurück04.12.25 Neues DFG-Projekt bewilligt04.12.25
Neues DFG-Projekt bewilligt04.12.25 Beteiligung am schwedischen Forschungs-Infrastrukturprojekt ATLASS04.12.25
Beteiligung am schwedischen Forschungs-Infrastrukturprojekt ATLASS04.12.25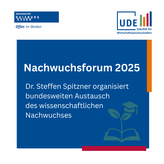 Nachwuchsforum 202504.12.25
Nachwuchsforum 202504.12.25 Noch lange nicht auf Augenhöhe: Neues DFG-Projekt zur Geschlechterparität in der VWL27.11.25
Noch lange nicht auf Augenhöhe: Neues DFG-Projekt zur Geschlechterparität in der VWL27.11.25 Wissenschaftlicher Workshop an der TU Dortmund26.11.25
Wissenschaftlicher Workshop an der TU Dortmund26.11.25 Martin Karlsson hält Keynote-Vortrag auf internationaler Konferenz in Indien26.11.25
Martin Karlsson hält Keynote-Vortrag auf internationaler Konferenz in Indien26.11.25 Bewerbungsphase für das PROMOS-Stipendium 2026 gestartet12.11.25
Bewerbungsphase für das PROMOS-Stipendium 2026 gestartet12.11.25 Forschung zu neuen Arbeitswelten: Prof. Dr. Andrea Herrmann untersucht die Gig Economy07.11.25
Forschung zu neuen Arbeitswelten: Prof. Dr. Andrea Herrmann untersucht die Gig Economy07.11.25